Arduino und Raspberry Pi stehen bei vielen Projekten rund um DIY-Technik oder Prototyping im Rampenlicht. Während Arduino Einfachheit und direkte Hardwaresteuerung bietet, liefert Raspberry Pi die notwendige Rechenleistung für datenintensive Anwendungen und Netzwerkkommunikation.
Zentrale Punkte
- Hardware: Arduino ist ein Mikrocontroller, Raspberry Pi ein Einplatinencomputer.
- Betriebssystem: Arduino arbeitet ohne OS, Raspberry Pi nutzt Linux-basierte Systeme.
- Kosten: Arduino eindeutig günstiger, Raspberry Pi jedoch leistungsfähiger.
- Anwendung: Steuerung vs. Multimedia & Datenverarbeitung.
- Prototyping: Beide Plattformen eignen sich – je nach Projekt unterschiedlich.
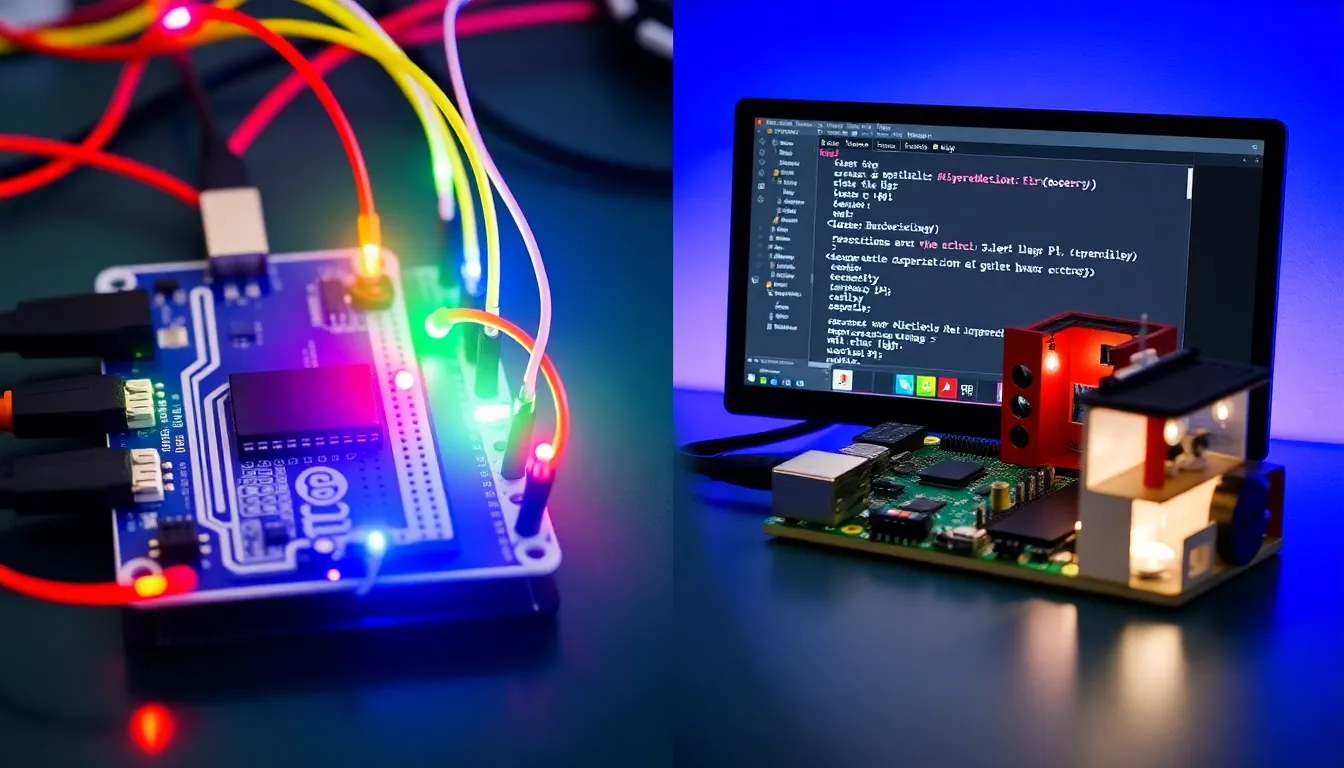
Technische Unterschiede zwischen Arduino und Raspberry Pi
Der auffälligste Unterschied liegt in der Architektur. Arduino basiert auf einem Mikrocontroller (häufig ATmega328), der speziell für Steuerung und einfache Logikaufgaben konzipiert ist. Es übernimmt Aufgaben wie das Regeln eines Motors oder das Ablesen eines Temperatursensors zuverlässig, auch ohne Netzverbindung. Im Gegensatz dazu arbeitet Raspberry Pi mit einem ARM-basierten Prozessor und verhält sich wie ein vollständiger Computer mit USB, HDMI und WLAN-Anbindung. Dadurch lassen sich Anwendungen wie Webserver oder KI-Prozesse umsetzen.
Ein weiterer Punkt: Arduino läuft nativ und benötigt kein Betriebssystem – der Code greift direkt auf die Hardware zu, was ihn schnell und zuverlässig in Echtzeit macht. Raspberry Pi hingegen verwendet Betriebssysteme wie Raspberry Pi OS oder Ubuntu, wodurch Multitasking, grafische Oberflächen und komplexe Software-Stacks möglich werden, jedoch mit deutlich höherem Energiebedarf und längerer Bootzeit.
Gerade in Projekten, in denen du strikte Echtzeit-Anforderungen hast (z. B. bei zeitkritischen Messungen oder schnellen Motorsteuerungen), ist Arduino unschlagbar. Betriebsystembasierte Systeme wie Raspberry Pi können aufgrund von Hintergrundprozessen und verschiedensten Diensten Verzögerungen verursachen. Dafür ist der Pi jedoch in der Lage, große Datenmengen zu verarbeiten und mehrere Tasks zugleich auszuführen. Damit liegt die Wahl zwischen Arduino und Raspberry Pi häufig darin begründet, ob du eher auf Zuverlässigkeit in Echtzeit oder Rechenstärke und Flexibilität setzen möchtest.
Hinzu kommt der Aspekt der Programmierung. Auf Arduino wird meist in C oder C++ entwickelt, wobei viele Bibliotheken für Sensoren, Motoren und andere Hardwarekomponenten existieren. Raspberry Pi bietet hingegen ein vollwertiges Linux, wo du zwischen Python, C, Java, Node.js und vielen anderen Sprachen wählen kannst. In der Praxis bedeutet das, dass du auf dem Pi komplexere Softwaremodule einsetzen kannst – bis hin zu Machine Learning mit entsprechenden Bibliotheken.
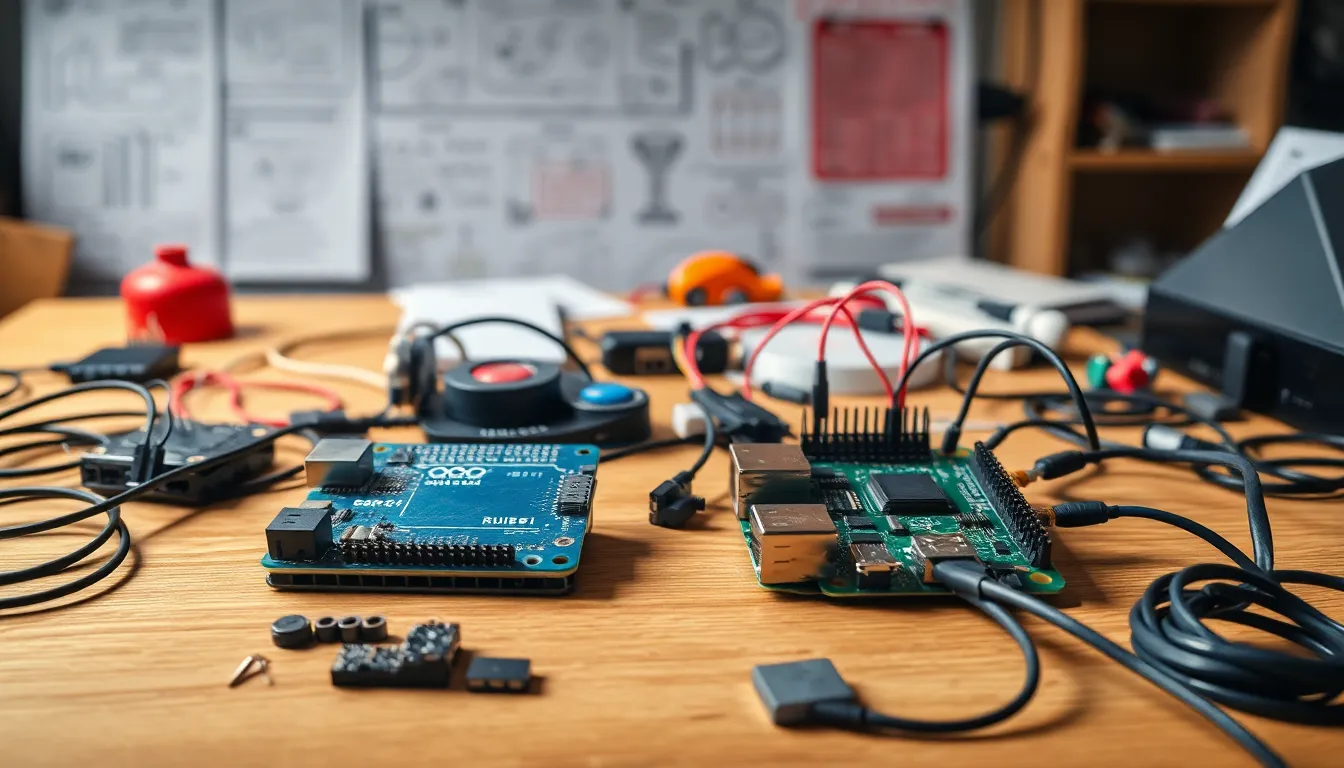
Preis-Leistungs-Vergleich: Worauf kommt es an?
Ein Arduino Uno kostet je nach Anbieter zwischen 20 und 30 Euro. Komplett-Kits mit Sensoren sind bereits ab 35 Euro erhältlich. Der Preis für einen aktuellen Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM liegt bei etwa 60–80 Euro. Für Modell 5 sind nochmals 20–30 Euro mehr zu rechnen, insbesondere mit Zubehör wie Kühlkörper oder Gehäuse. Im direkten Vergleich lohnt sich Arduino für einfache Steuerungen und Sensorprototypen. Raspberry Pi kostet mehr, bietet aber USB-Schnittstellen, HDMI-Ausgabe, kabellose Verbindungsmöglichkeiten (Wi-Fi, Bluetooth) und Kompatibilität mit modernen Softwareplattformen.
Daher empfehle ich: Wer einen schlichten Türsensor oder eine Zeitschaltuhr realisieren möchte, spart bares Geld mit Arduino. Projekte mit Anzeigen, Datenbankanbindung oder Audioausgabe sind mit Raspberry Pi deutlich einfacher und ganz ohne zusätzliche Rechneranbindung umsetzbar.
Es gilt jedoch nicht nur der einmalige Anschaffungspreis. Manche Anwendungen benötigen ein dauerhaftes oder zumindest häufig aktives Netzwerk. Dafür muss beim Arduino oft mit zusätzlichen Shields oder Modulen nachgerüstet werden, was die Kosten in die Höhe treibt. Beim Raspberry Pi ist alles integriert. Andersherum betrachtet kann der geringere Stromverbrauch eines Arduino auf Dauer günstiger sein, wenn das Gerät jahrelang ohne Pause laufen soll. Auch hinsichtlich Unterhaltskosten, beispielsweise für SD-Karten, Gehäuse, Zubehör oder zusätzliche Peripherie, lohnt es sich, die Gesamtkosten deines Projekts im Blick zu behalten.
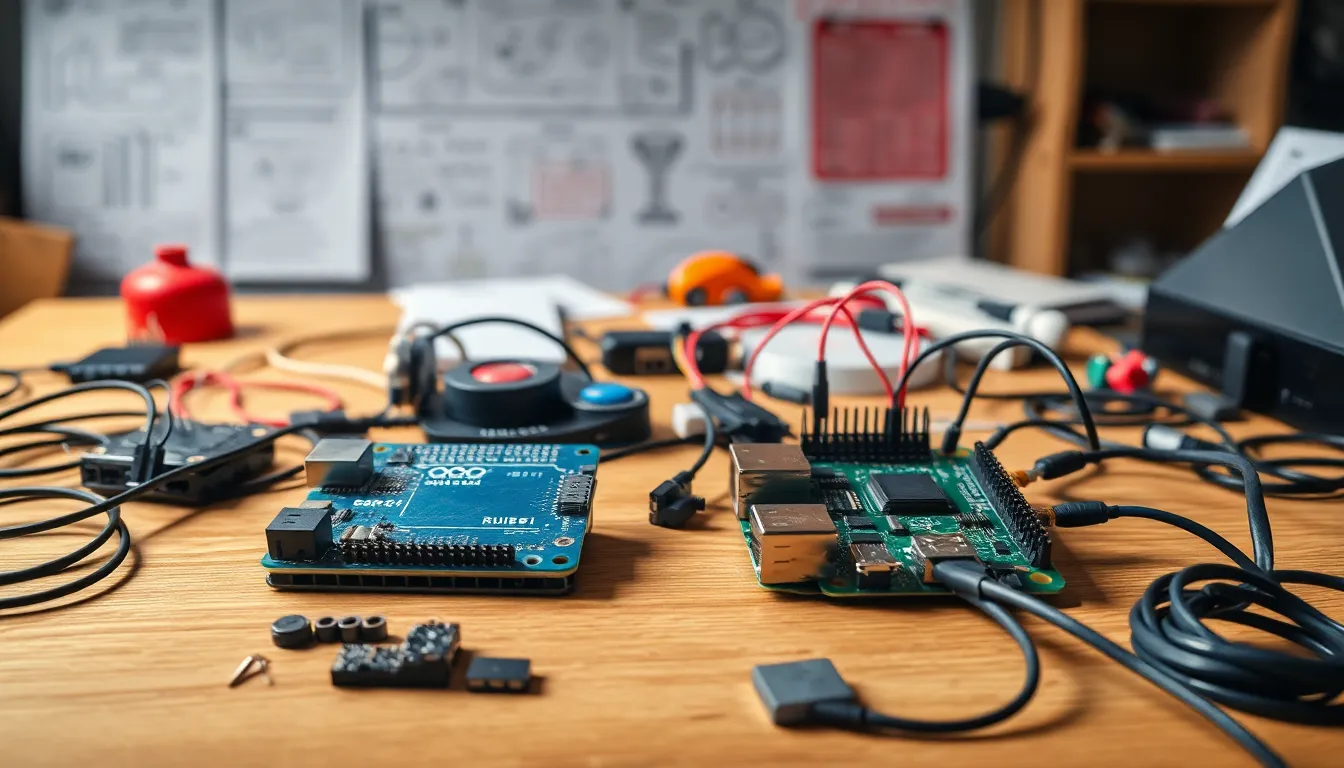
Typische Einsatzszenarien im Vergleich
Arduino eignet sich hervorragend für fest definierte Abläufe. Die Stärken liegen im berechenbaren Verhalten bei Stromausfall oder Neustart. Damit ist die Plattform toll für Alltagsautomatisierungen wie Gartenbewässerung oder Alarmanlagen. Raspberry Pi dagegen kommt ins Spiel bei dynamischeren Anwendungen: Wenn Kameraüberwachung, Echtzeit-Analyse von Daten oder Netzwerkschnittstellen gebraucht werden, stoßen Mikrocontroller schnell an ihre Grenzen.
Beispiel: Für ein automatisiertes Gewächshaus mit Temperatur-, Licht- und Feuchtigkeitssensor reicht Arduino völlig. Sobald aber Datenlogging auf einer lokalen Datenbank oder Cloud-Anbindung gefragt sind, macht Raspberry Pi das Leben leichter.
Gerade im Bildungsbereich, etwa bei Schulprojekten oder Workshops, setzen viele Einsteiger auf Arduino, um die Prinzipien der Programmierung und Elektrotechnik zu erlernen. Es ist einfach, mit Steckbrettern und Sensoren erste Versuche zu machen, ohne sich um Betriebssysteme oder komplexe Software zu kümmern. Sobald die Teilnehmer jedoch mehr Interaktivität, Grafiken oder umfangreichere Analysen benötigen, ist der Schritt zum Raspberry Pi naheliegend. So kann ein Schul- oder Uni-Projekt beispielsweise erst das reine Messen über Arduino realisieren und dann auf dem Pi die gesammelten Daten in Echtzeit visualisieren oder KI-Algorithmen darauf anwenden.
Ein weiteres spannendes Szenario ist die Robotik. Während bei einfachen Line-Follower-Robotern als Herzstück oft ein Arduino für die Motorsteuerung und Sensorik reicht, nutzt man bei komplexeren Systemen, wie autonomen Fahrzeugen mit Kamera- und Bilderkennung, gerne den Raspberry Pi. Hier kommt die Fähigkeit ins Spiel, mehrere Prozesse gleichzeitig zu managen und komplizierte Algorithmen in vertretbarer Zeit ausführen zu können.
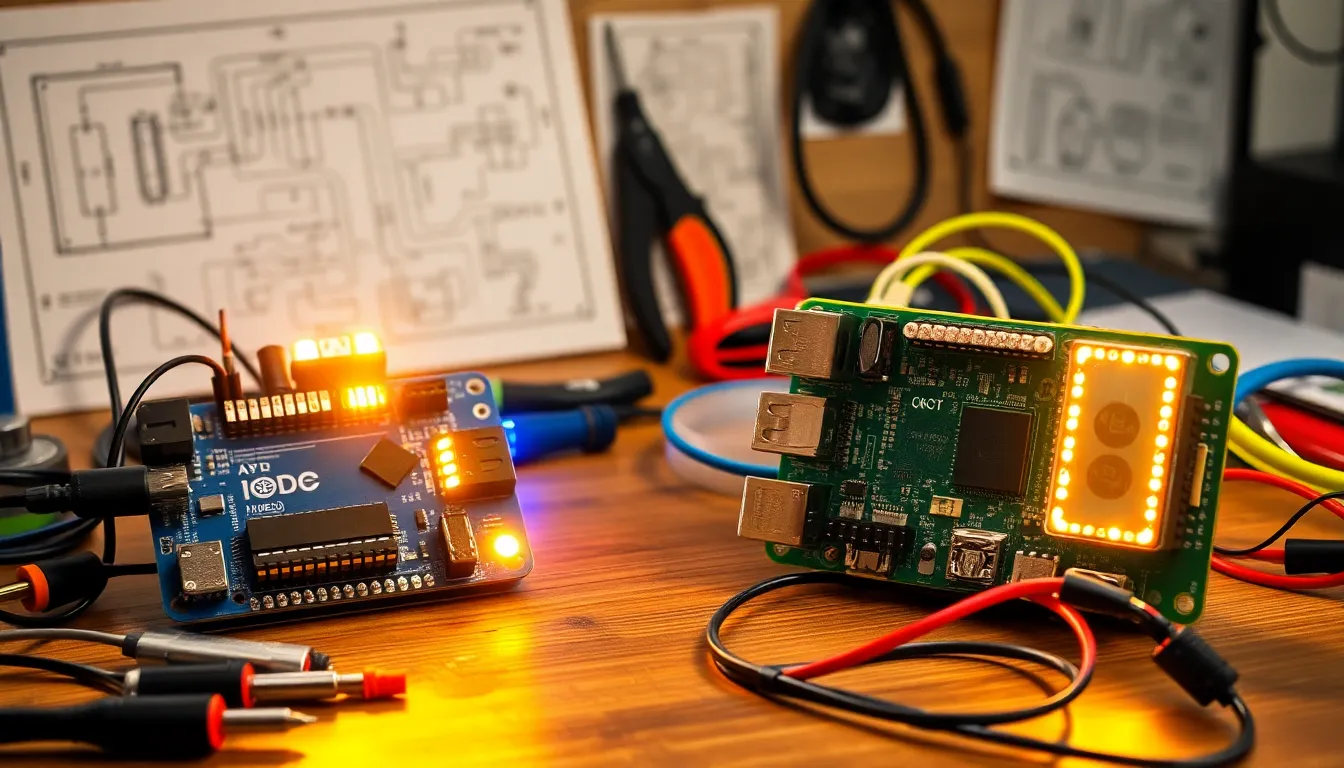
Integrierte Schnittstellen und Erweiterungen
Arduino verfügt über eine beschränkte Anzahl an digitalen und analogen Ein- und Ausgängen (GPIOs). Erweiterungen wie WLAN oder Bluetooth erfordern Zusatzmodule wie ESP8266 oder HC-05. Raspberry Pi hingegen bietet integriertes Bluetooth, mehrere USB-Anschlüsse und HDMI gleich ab Werk. Das macht ihn besonders geeignet für Multimedia-Projekte oder wenn Bildschirme, Tastaturen oder größere Netzwerke gefragt sind.
Ich schätze besonders die GPIO-Pins auf beiden Geräten. Damit lassen sich LEDs, Relais oder Displays direkt ansteuern. Der Unterschied liegt im Timing: Arduino ist perfekt für zyklische Aufgaben im Millisekundenbereich, Raspberry Pi für Aufgaben, die Netzwerk- oder Dateizugriffe benötigen.
Bei professionellen Projekten kann Arduino auch als Slave-Gerät fungieren, das ausschließlich zeitkritische oder hardwarenahe Aufgaben übernimmt. Raspberry Pi dagegen fungiert als Master, sammelt und verarbeitet Daten und sorgt für eine komfortable Benutzerschnittstelle. Solch eine Master-Slave-Architektur ist bei IoT-Anwendungen beliebt, weil sie das Beste aus beiden Welten vereint. Der Arduino kann die Messwerte zuverlässig erfassen, selbst wenn der Pi ausfällt oder neu startet. Sobald der Pi wieder verfügbar ist, werden die Daten übertragen und ausgewertet.
Im Industriekontext kommen oft sogenannte HATs (Hardware Attached on Top) für Raspberry Pi zum Einsatz. Das sind Erweiterungsplatinen, die direkt auf die GPIO-Pins des Pi aufgesteckt werden. Damit kannst du schnell zusätzliche Funktionen wie analoge Inputs, Motor-Treiber oder spezielle Sensorik hinzufügen, ohne viel Kabelwirrwarr. Arduino bietet vergleichbare Shields, sodass beispielsweise WLAN, GSM oder GPS-Funktionen ergänzt werden können. Hier entscheidet meist nur, auf welcher Plattform du dich wohler fühlst oder welche Community deine Wünsche besser abdeckt.
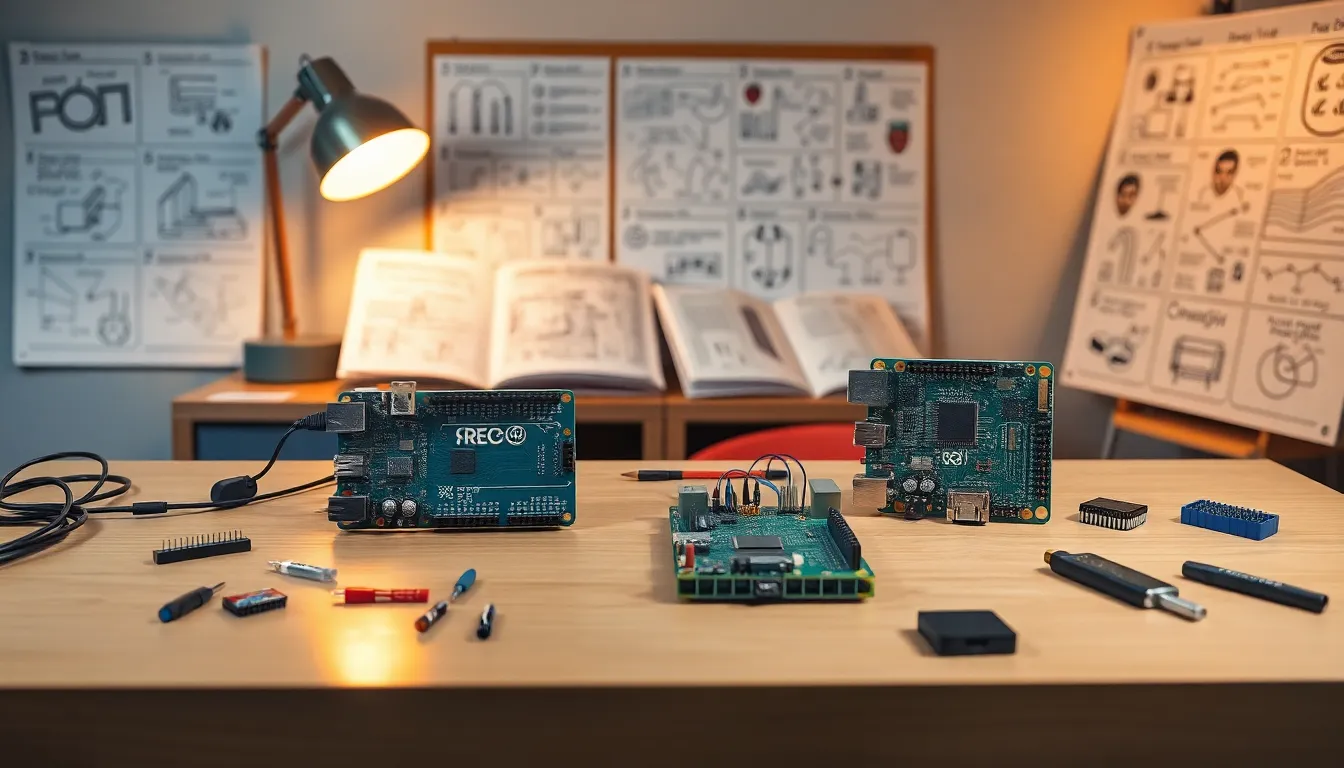
Vergleichstabelle: Technische Daten im Überblick
Zur Veranschaulichung der Unterschiede zeige ich dir hier die wichtigsten technischen Fakten beider Plattformen:
| Eigenschaft | Arduino Uno | Raspberry Pi 4 |
|---|---|---|
| Prozessor | ATmega328 (16 MHz) | Quad-Core ARM Cortex-A72 (1.5 GHz) |
| RAM | 2 KB | 1–8 GB (je nach Modell) |
| Speicher | 32 KB Flash | MicroSD (bis 256 GB) |
| Netzwerkschnittstellen | Externe Module notwendig | Gigabit-LAN, WLAN, Bluetooth |
| Betriebssystem | Keines | Linux-basiert |
| Preis | 20–30 € | 60–120 € |
Beachte, dass die Zahlen bei Raspberry Pi je nach Modell variieren können. Auch der aktuelle Raspberry Pi 5 setzt auf einen schnelleren Prozessor und bietet neue Funktionen wie ein verbessertes Netzteil oder schnellere Schnittstellen. Trotzdem bleibt das Grundprinzip: Pi ist ein Komplettsystem mit höherer Leistung und mehr Möglichkeiten, während Arduino auf maximale Einfachheit und Stabilität ausgelegt ist.
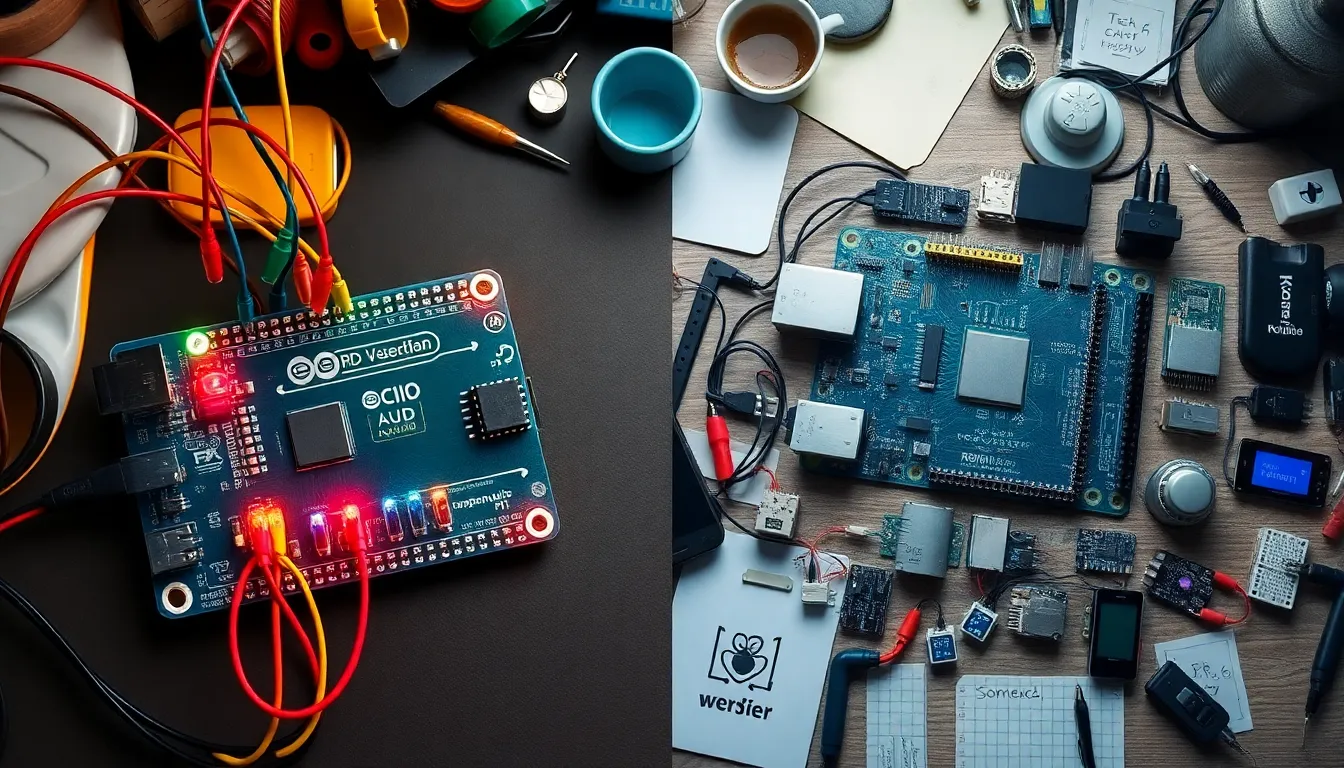
Prototypen entwickeln – was passt besser?
Beim technischen Prototyping ist die Wahl nicht klar schwarz oder weiß. Arduino glänzt bei Hardware-Konzepten, in denen schnelle Ansteuerung oder Stromersparnis gewünscht sind. Raspberry Pi dient mir als idealer Server für das Backend oder als Touchscreen-Oberfläche für das Frontend. In meiner Werkstatt laufen häufig beide Module gleichzeitig. Während Arduino die Sensordaten sammelt, verarbeitet Raspberry Pi die Daten weiter oder visualisiert sie auf einem Bildschirm.
So entsteht ein Hybrid-System – kostengünstig, flexibel und wartbar. Die große Community liefert für beide Lösungen Tutorials, Bibliotheken und Tools, mit denen Projekte schnell wachsen können.
In der Praxis kannst du damit unterschiedliche Entwicklungsziele verfolgen. Einerseits bietet der Pi aufgrund seines Linux-Betriebssystems eine Fülle an Software-Tools und Sprachoptionen. Möchtest du etwa Node-RED nutzen, um deine Sensordaten zu verarbeiten und via Dashboard darzustellen, ist das mit Raspberry Pi innerhalb weniger Schritte umgesetzt. Andererseits erlaubt ein Arduino-basierter Prototyp meist, an einem einzigen Mikrocontroller-Board zu beginnen und alles Notwendige an Sensoren und Aktoren anzuschließen. Du brauchst keine aufwendige Softwareinstallation und hast schnell ein lauffähiges Grundgerüst.
Je umfangreicher deine Prototypen werden, desto eher brauchst du vielleicht auch Storage-Lösungen, um Daten langfristig zu speichern. Das ist ein Fall, bei dem der Raspberry Pi punktet, da er eine SD-Karte nutzt und du damit mehrere Gigabyte an Speicherkapazität für Logfiles, Datenbanken oder andere Anwendungen zur Verfügung hast.
Community und Open Source: Entscheidender Erfolgsfaktor
Beide Plattformen profitieren von einer Vielzahl an Open-Source-Initiativen. Arduino IDE erlaubt einfache Codeentwicklung direkt auf dem Mikrocontroller. Raspberry Pi nutzt Tools wie Python, Node-RED oder PHP-Stacks. Die Dokumentationen sind umfangreich, Foren beantworten nahezu jede Frage. Auch die deutsche Makerszene ist stark und unterstützt bei Problemen oder Ideenfindung.
Ich empfehle, beide Plattformen parallel zu erkunden. Der Lerneffekt ist enorm – besonders, wenn es darum geht, Software mit Hardware zu verbinden. Langfristig deckst du damit ein breites Spektrum technischer Herausforderungen ab.
Zudem ist das Teilen eigener Projekte oder Snippets in der Community sehr beliebt. Auf Plattformen wie GitHub oder in Foren findet man unzählige Beispiele, wie man Sensoren, Displays oder Motoren mit Arduino ansteuert. Gleiches gilt für Raspberry Pi, wo Projekte von Heimautomation bis hin zur KI-gestützten Bilderkennung besprochen werden. Dank dieser offenen Kultur werden kleine Fehlerquellen schnell identifiziert und man erhält rasch Feedback oder Verbesserungsvorschläge.
Ein wichtiger Aspekt der Community-Arbeit ist die nachhaltige Wissensvermittlung. Da sowohl Arduino als auch Raspberry Pi von Einsteigern genutzt werden, gibt es eine große Bandbreite an Tutorials in verschiedensten Sprachen. Auch fortgeschrittene Anwender oder Profis lassen sich inspirieren und erweitern ihre Projekte. So entstehen komplizierte IoT-Lösungen, die ohne die gemeinschaftliche Arbeit mehr Zeit und Aufwand erfordern würden.
Mein persönlicher Praxis-Tipp
Baue klein mit Arduino und plane groß mit Raspberry Pi. Ich beginne viele Projekte mit einem simplen Arduino-Board, bevor ich später bei Bedarf auf Pi-Technologie erweitere. Das spart Geld und verhindert unnötige Komplexität. Manche Ideen funktionieren auch dauerhaft mit Arduino – besonders dort, wo keinerlei Benutzerschnittstelle gebraucht wird.
Du kannst Sensorwerte z. B. über Arduino sammeln, mit drahtlosen Modulen an einen Raspberry Pi senden, und dort eine benutzerfreundliche Oberfläche darstellen. Diese Kombination macht aus simplen Sensorboards leistungsstarke Smart-Controller, ohne ständig online sein zu müssen.
Gerade in Smart-Home-Projekten kann diese Trennung Sinn ergeben: Ein Arduino misst beispielsweise den CO2-Gehalt und die Luftfeuchtigkeit im Raum. Die gemessenen Daten schickt er im 5-Minuten-Takt via WLAN-Modul an einen Raspberry Pi, der das Ganze in einer Datenbank ablegt und grafisch aufbereitet. Du hast somit die volle Kontrolle und bleibst flexibel, ohne dass dein Mikrocontroller unnötig komplex werden muss. Zudem kannst du Erweiterungen am Pi vornehmen (etwa ein Touchdisplay oder Sprachausgabe), ohne den schlanken Kern des Arduino-Codes zu gefährden.
Erweiterte Überlegungen: Stromverbrauch und Zuverlässigkeit
Manche Projekte sind stark von Energieeffizienz abhängig, beispielsweise, wenn sie mit Batterie oder Solarzellen betrieben werden sollen. Hier liegt der Stromverbrauch des Raspberry Pi meist deutlich über dem eines Arduino. Während ein Arduino Uno teils nur wenige Milliampere benötigt, kann der Pi bei Volllast Stromaufnahmen im Bereich mehrerer hundert Milliampere bis Ampere besitzen, insbesondere die neueren Modelle.
Gerade bei Sensoren, die im Freien oder an schwer zugänglichen Orten arbeiten, ist ein geringer Stromverbrauch entscheidend. Ein Arduino mit cleverer Programmierung kann in den Schlafmodus gehen und nur bei Bedarf messen. Der Pi ist dafür weniger geeignet, weil der Betrieb eines Linux-Betriebssystems immer eine gewisse Grundlast verursacht. Allerdings gibt es Ansätze, den Pi energiesparend zu konfigurieren, indem man unnötige Dienste deaktiviert oder ihn bei Nichtgebrauch herunterfährt. Letztlich musst du aber genau abwägen, wie oft mess- und steuernd eingegriffen werden soll.
Auch in puncto Zuverlässigkeit haben beide Vor- und Nachteile. Ein Mikrocontroller ohne Betriebssystem kann praktisch dauerhaft laufen, ohne dass Updates oder Reboots erforderlich wären. Das verringert das Risiko von Ausfällen erheblich. Der Raspberry Pi ermöglicht zwar regelmäßige Sicherheitsupdates, kann aber im ungünstigsten Fall durch fehlerhafte Updates oder Stromausfall in Mitleidenschaft gezogen werden. Dennoch ist Raspberry Pi, gerade abseits kritischer Echtzeitfunktionalitäten, sehr ausfallsicher, solange man auf eine stabile Stromversorgung und saubere SD-Karten achtet. In kommerziellen Settings werden Pi-Systeme häufig mit speziell konfigurierten Images betrieben, die Robustheit weiter steigern.
Ausblick: Neue Entwicklungen und Trends
Während der Arduino-Uno-Formfaktor fast unverändert geblieben ist, haben sich zahlreiche Varianten entwickelt, etwa Arduino Mega, Nano oder MKR-Boards mit integriertem WLAN. Auch im Raspberry-Pi-Universum tut sich einiges: Mit jedem neuen Modell verbessern sich Rechenleistung, RAM-Kapazitäten und Schnittstellen. Gleichzeitig bleibt die wachsende Raspberry Pi Foundation dabei, ihre Produkte preislich erschwinglich zu halten, um Bildung und kreative Projekte zu unterstützen.
Für die Zukunft ist zudem klar, dass Künstliche Intelligenz und Machine Learning stärker auf Edge-Geräten, also direkt vor Ort, zum Einsatz kommen. Hier könnten kompakte Boards, z. B. ein Raspberry Pi mit zusätzlicher KI-Beschleunigung oder spezielle Arduino-Boards mit integrierten Tensor-Chips, an Bedeutung gewinnen. Möchtest du KI-Algorithmen direkt im heimischen Gewächshaus fahren, empfiehlt sich eher ein Raspberry Pi, da er neuronale Netzwerke deutlich schneller verarbeiten kann als ein Mikrocontroller. Gleichzeitig wird es immer neue Arduino-Modelle geben, die auf Low-Power-Lösungen für Sensorik und Aktorik ausgerichtet sind.
Zusammenfassung
Arduino und Raspberry Pi leisten unterschiedliche Aufgaben. Die Wahl hängt vom Projektziel ab: Brauchst du schnelle, direkte Steuerung ohne viel Drumherum, ist Arduino deine Wahl. Möchtest du mehrere Prozesse, Netzwerkzugriff oder Benutzeroberfläche einbinden, greif zu Raspberry Pi. Für viele Anwendungen macht die Kombination beider Systeme Sinn – einfach, weil sie sich optimal ergänzen. Mit beiden Bausteinen hast du ein starkes Fundament für kreative, nutzerorientierte Technikkonzepte.

